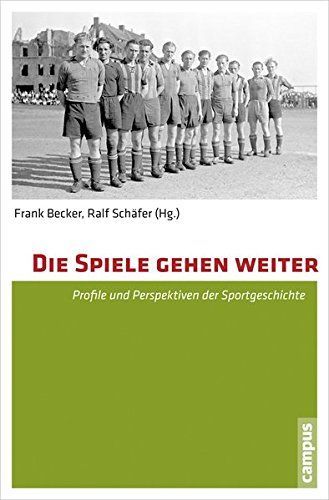
Die Spiele gehen weiter Profile und Perspektiven der Sportgeschichte
Einleitung Frank Becker und Ralf Schäfer Sportgeschichtliche Themen stoßen nicht nur unter wissenschaftlichen Spezialisten oder Sportliebhabern, sondern auch in einer breiteren Öffent-lichkeit auf großes Interesse. Als 2005 die Studie von Nils Havemann zur Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes in der NS-Zeit publiziert wurde , kam es zu einer von intensiver Medienberichterstattung begleiteten Debatte. 2009-2011 lösten die Carl-Diem-Biographie von Frank Becker und die Carl Diem gewidmete gesellschaftsgeschichtlich angelegte Studie von Ralf Schäfer einen regelrechten "Historikerstreit" aus, in den auch die geschichtspolitische Debatte um die Umbenennung von nach Carl Diem benannten Straßen, Stadien und Hallen hineinwirkte. Zuletzt sorgte 2012/13 eine vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Auftrag gegebene Studie zur Geschichte des Dopings in der Bundesrepublik Deutschland für Furore. Die beauftragten Historiker stellten die These auf, auch in Westdeutschland habe es ein vom Staat heimlich begünstigtes "Dopingsystem" gegeben, das in manchen Zügen den Verhältnissen in der früheren DDR ähnlich gewesen sei. Diese These führte zu hitzigen Auseinandersetzungen. Schon diese Themen zeigen, dass es im Bereich der Sportgeschichte viele strittige Sachgebiete und umstrittene Forschungsfelder gibt. Oft wir-ken auch politische, ja sogar persönliche Interessen in die Darstellung die-ser Sachgebiete hinein; nicht selten hat die Forschung zunächst Hinder-nisse aus dem Weg zu räumen, bevor sie sich unabhängig und mit den üblichen Methoden historischer Analyse an die Arbeit machen kann. In diesem Sinne will auch der vorliegende Sammelband dazu beitragen, die deutsche Sportgeschichte weiter für eine sachgerechte, kritisch-aufkläreri-sche wissenschaftliche Auseinandersetzung zu öffnen. Mit besonderem Nachdruck ist dabei auf die Rolle des deutschen Sports in der NS-Zeit hinzuweisen. Nach wie vor wird von vielen Sport-verbänden, Sportfunktionären und Sportwissenschaftlern die Auffassung vertreten, der deutsche Sport habe zwar eine NS-Verwaltungsspitze erhal-ten, sei aber ansonsten vom Nationalsozialismus kaum berührt worden - er habe sich gemäß sportlicher Eigenlogiken entwickelt. Insofern seien weder das Jahr 1933, noch das Jahr 1945 entscheidende Zäsuren gewesen. Schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik habe der Sport primär als modernisierender Faktor gewirkt, und dies sei auch in der NS-Zeit der Fall gewesen, bevor der Sport nach 1945 endgültig Teil des Siegeszuges einer westlich geprägten Moderne geworden sei. Dagegen steht die Auffassung, dass dieses Bild einseitig und beschö-nigend ist. Schon der Sportbetrieb des Kaiserreichs und der Weimarer Republik war nur in Teilaspekten westlich-modern, ansonsten aber auch nationalistisch und militant, in manchen Bereichen sogar völkisch und antisemitisch. Letztere Tendenzen erhielten nach 1933 großen Auftrieb, als der NS-Staat den Sport als Mittel zur "Verbesserung von Volksgesundheit und Volkskraft" für seine "rassenhygienischen" Ziele instrumentalisierte. Darüber hinaus spielte der Sport als Propagandamittel eine wichtige Rolle: Er sollte die Überlegenheit des "nordischen Menschen" demonstrieren. Zudem diente er der Inszenierung der Volksgemeinschaft, realisierte ihre Prinzipien, wozu auch gehörte: Wer von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen war, blieb auch vom Sport ausgeschlossen. Jüdische Mitglieder wurden in zahlreichen deutschen Sportvereinen unmittelbar nach der Machterteilung an die NSDAP ausgestoßen. Oftmals bedurfte es dazu gar keiner staatlichen Anweisung; die Vereine übten sich in vorauseilendem Gehorsam. Die Behandlung von "heißen Eisen", die wissenschaftliche Erhellung von Kapiteln der deutschen Sportgeschichte, die bis zum heutigen Tag hoch umstritten sind, ist ein Anliegen des geplanten Bandes. Kombiniert werden soll es mit einem zweiten Anliegen: Hier lautet die Frage, welchen Stellenwert Themen aus dem Bereich des Sports in eher systematischer Hinsicht für die geschichtswissenschaftliche Forschung haben beziehungs-weise haben können. Was interessiert die Geschichtswissenschaft am Sport? Welche Sektoren und Sparten der historischen Forschung greifen auf dieses Themengebiet zu? Nicht die chronologische Einteilung der Ge-schichte steht nunmehr im Vordergrund - in diesem Sinne könnte man das oben Ausgeführte mit einem Interesse der NS-Forschung am Sport in Verbindung bringen -, sondern es geht um spezifische Ansätze der historischen Forschung, die in den letzten Jahren in der Fachwelt viel Aufmerksamkeit beansprucht haben. Diese Ansätze sind vor allem in der Geschichtswissenschaft, aber auch von der dem Fach Sportwissenschaft zugeordneten Sportgeschichtsschreibung zur Geltung gebracht worden. Insofern ist es ein weiteres Anliegen des geplanten Bandes, den Dialog zwischen Geschichtswissenschaft und Sportwissenschaft zu intensivieren. Unter den Autorinnen und Autoren des Bandes befinden sich daher Historiker(innen) und Sportwissenschaftler(innen). Um welche Ansätze aber handelt es sich? An erster Stelle soll das For-schungsgebiet der "symbolischen Kommunikation" genannt werden. Menschliches Handeln erfolgt nie allein praktisch-zweckorientiert, sondern transportiert stets auch Bedeutungen; auch Handlungen besitzen in diesem Sinne den Status von Zeichen. Die gesamte Welt der Sportpraxis hat somit auch eine kommunikative Dimension; seit es den Sport gibt, wird er von unterschiedlichsten Deutungen begleitet. Viele Gesellschaften haben im Sport ein Spiegelbild ihrer sozialen Praxis gesehen, andere ein Leitbild für die Zukunft, wieder andere ein Gegenbild zur schlechten Realität, eine Sphäre mithin, in der man zumindest momenthaft, entführt in die Welt des Spiels, abweichende Erfahrungen machen darf. Je höher der Stellenwert des Sports in den Gesellschaften des 20. Jahrhunderts wurde, desto mehr drängte sich die Frage auf, wer den Sport in seinem Sinne und in seinem Interesse deutete - und ihn damit zu einem potenziell universalen "Sinnschema" machte, das über seine Symbolhaftigkeit und Metaphorizität für immer größere Teile der Bevölkerung die Wahrnehmung einer immer größeren Zahl von Realitätsbereichen steuerte. Zweitens ist auf die "Körpergeschichte" zu verweisen. Dieser Ansatz thematisiert die Wahrnehmung und Deutung von Körperlichkeit durch historisch handelnde Menschen. Die Geschichte der Medizin, die Ge-schichte der Sexualität und die Habitusforschung, um nur einige Beispiele zu nennen, fließen auf diesem Themenfeld zusammen - und auch die Ge-schichte des Sports ist bedeutsam, weil dieser seit dem späten 19. Jahrhun-dert entscheidend dazu beigetragen hat, die Körperlichkeit des modernen Menschen zu formen und zu definieren. Vor allem die Unterwerfung des Körpers unter ein Kontroll-, Mess- und Leistungsregime spielt hier eine überragende Rolle. Als drittes Beispiel soll die Mediengeschichte firmieren. Die kulturalistische Wende in der Geschichtswissenschaft seit den neunziger Jahren hat das Interesse auf sogenannte "Realitätskonstruktionen" gelenkt, die maßgeblich von Medien geleistet werden. Um zu begreifen, wie in histori-schen Situationen bestimmte Deutungen der Wirklichkeit entstanden sind, verbreitet und durchgesetzt wurden, ist ein Blick auf die zeitgenössisch verfügbaren Medien unverzichtbar. Auch Sportereignisse sind in dieser Hinsicht Medienereignisse, sie werden von den Medien dargestellt, inter-pretiert und stilisiert. Wechselwirkungen zwischen Medien- und Sportgeschichte sind aber auch noch auf einer anderen Ebene wirksam: Die Ent-wicklung der Medien verdankt der Sportgeschichte wichtige Anstöße. Bei zentralen Sportereignissen des 20. Jahrhunderts sind wiederholt neue Me-dientechnologien erstmals in großem Maßstab zur Anwendung gekommen; erinnert sei an den UKW-Funk und die Fernsehübertragungen bei den Olympischen Sommerspielen von 1936 in Berlin, oder an die TV-Übertragungen via Satellit, die bei den Spielen von Mexiko-Stadt 1968 den gesamten Erdkreis erreichten. Allen drei oben genannten Themenkreisen sind einzelne Beiträge des geplanten Sammelbandes gewidmet. Hinzu kommen weitere Themen und Ansätze, die im Folgenden anhand einer kurzen Präsentation der einzelnen Aufsätze vorgestellt werden: Nadine Rossol schlägt in ihrem Aufsatz über "Politische Symbolik bei Massenveranstaltungen des deutschen Sports zwischen den Weltkriegen" eine Brücke von der Sportgeschichte zur Politischen Kulturforschung. Große Sportfeste erzielten eine enorme Publikumswirkung, die die Veranstalter nutzen wollten, um politische Botschaften zu kommunizieren - auch wenn die Zuschauer sich oft desinteressiert hieran zeigten. In der Weimarer Republik wurde der Streit um die schwarz-weiß-rote Fahne des Kaiserreichs oder das schwarz-rot-goldene Banner der Republik sogar im Lokalsport ausgetragen; die sozialdemokratisch geführte preußische Regierung wollte dafür sorgen, dass sich überall die neuen Farben der Demokratie etablierten. Ebenfalls sinnfällig wurde der Zusammenhang zwischen Sport und Demokratie bei den Verfassungsfeiern am 11. August, für die Reichskunstwart Edwin Redslob Sportveranstaltungen ansetzte, weil er der Meinung war, dass in ihnen der Geist der Gleichheit und der Gemeinschaft besonders gut zum Ausdruck komme. Fragen von nationaler Einheit und territorialer Unversehrtheit waren das große Thema der Deutschen Kampfspiele. Rossol untersucht vor allem die Kölner Spiele von 1926, bei denen die gerade erfolgte Räumung der Kölner Besatzungszone durch die Ententemächte als Beitrag zur Wiederherstellung der Unversehrtheit des Körpers der Nation gefeiert wurde. Zudem waren Vertreter des so genannten ›Auslandsdeutschtums‹ zugegen - die Kampfspiele sollten das Fest aller Deutschen in Europa und der Welt sein. An diese Idee knüpfte auch das nationalsozialistische Deutsche Turn- und Sportfest 1938 in Breslau an. Die deutschen Bewohner des unweit gelegenen Sudetenlandes wurden als Teil der Nation adressiert, der bald ›heim ins Reich‹ geholt werden würde. Zuschüsse zu Anreise und Unterkunft ermöglichten es gerade sudetendeutschen Athleten, nach Breslau zu kommen, um ihrerseits den Willen zum Anschluss an Deutschland zu bezeugen. Michel Foucault und die historische Diskursanalyse stehen Pate für den Beitrag von Rolf Parr über "Sport und Diskursgeschichte. Nationalstereotype in der Fußballberichterstattung". Begreift man nationale Identitäten als diskursiv konstruiert, so gebührt den Stereotypen besondere Beachtung; Selbst- und Fremdzuschreibungen basieren in hohem Maße auf solchen Klischees, die auch und gerade in populären Kontexten wie der Fußballberichterstattung Verwendung finden. Parrs Untersuchung nimmt von der Fußballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz ihren Ausgang. Obwohl die deutsche Mannschaft ihren WM-Sieg vor allem einem modernen Spielsystem verdankte, das mit schnellen Positionswechseln arbeitete, setzte sich in der Öffentlichkeit die Deutung durch, Kampfgeist, Disziplin und Kameradschaft seien die Garanten des Erfolges gewesen. Dieser positiven Charakterisierung standen - als die andere Seite derselben Medaille - jedoch in den folgenden Jahrzehnten die negativen Merkmale einer mangelnden Technik und Spielästhetik gegenüber; die Deutschen spielten effizient, aber nicht schön. Was aber geschah mit diesen Stereotypen, als die deutsche Nationalmannschaft unter den Bundestrainern Jürgen Klinsmann und - vor allem - Joachim Löw ihre Spielweise veränderte? Parrs primär auf Presseerzeugnisse gestützte Analyse des öffentlichen Diskurses erweist, dass den Deutschen nun attestiert wurde, sie spielten mit der unbekümmerten Leichtigkeit und Eleganz der Niederländer, ja der Brasilianer; umgekehrt fanden sich die Niederländer, primär bei der WM 2010 in Südafrika, als ›Deutsche‹ charakterisiert. Bei oberflächlicher Betrachtung wurden die alten Nationalstereotype also aufgeweicht; dagegen argumentiert Parr, es sei der beste Beleg für die Dauerhaftigkeit der Stereotype, dass sie ihre Gestalt nicht veränderten, auch wenn sie von Fall zu Fall unterschiedlichen Mannschaften zugeordnet würden. Bernd Wedemeyer-Kolwe lotet in seinem Beitrag "Sport und Disability History" die Stellung des "Behindertensports" in der Weimarer Republik zwischen ›Exklusion‹ und ›Inklusion‹ aus. Dazu wird die historische Be-dingtheit des Konzepts von Behinderung problematisiert. Die Sichtweise einer reinen "Opfergeschichte" ist zugunsten einer Analyseperspektive aufzugeben, in der die betroffenen Menschen als Subjekte mit eigenem Handlungsantrieb analysiert werden. In dieser Disability History werden mit der Beschreibung des "Nicht-Normalen" die Konzepte von Normalität genauso herausgearbeitet wie die Strategien von Inklusion und Exklusion, die sich aus den Konzepten von "Normalität" und "Behinderung" ergeben. Eine solche Sichtweise verlangt allerdings eine Fülle von Quellen aus der Sicht der Betroffenen. Eine erste Spurensuche fördert zahlreiche Hinweise auf Vereinigungen und Institutionen aus der Zeit der Weimarer Republik zutage, die auch in dieser Hinsicht als eine "Republik der Außeneiter" (Peter Gay) positiv hervorsticht. Zwar blieben grundsätzliche Trennungen der Sphären und Institutionen zwischen "behinderten" und "nichtbehinderten" Menschen erhalten - die Orthopädie für Menschen mit starken Verletzungen und dauerhaften Behinderungen, Heilgymnastik für leichtere und vorübergehende Schädigungen und der Vereins- und Leistungssport für gesunde Menschen ohne körperliches Handicap; zwar nahmen die Blinden- und Gehörlosenbewegung eine schon zuvor anerkannte Sonderstellung in der Gesellschaft ein, da Blinde und Gehörlose als bildungs- und erwerbsfähig galten, doch gab es neben den Gymnastik-, Turn- und Sportgruppen im Anschluss oder Umfeld älterer Gehörlosen- und Blindenschulen oder "Krüppelheimen" nach dem Ersten Weltkrieg eine Reihe von Vereinen, in denen Kriegsversehrte Sport trieben, teils zusammen mit "zivilversehrten" und körperlich gesunden Sportlern. Anhand zahlreicher Städte - Berlin, München, Bremen, Gießen, Aachen, Göppingen, und einiger ländlicher Vereine vermittelt der Beitrag teils überraschende Eindrücke in die Praxis der bürgerlichen und konfessionellen Sportverbände, in denen es erste, wenn auch vereinzelte Ansätze zu einem "inklusiven" Sport gab. So gelingt die erste Erschließung eines neuen körpergeschichtlichen Forschungsfelds, auch wenn die Quellenlage noch weitere Forschung notwendig macht. Carola M. Westermeier richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Darstellung von "Sportlerinnen in den Medien: Zwischen ›Mannweib‹ und ›Modell-körpern‹". Ausgangspunkt ihrer Analyse ist die Tatsache, dass die Ge-schlechtertrennung in kaum einem Bereich der Gesellschaft so akzeptiert ist wie im sportlichen Wettkampf - dabei galt Frauensport lange Zeit als Medium der Emanzipation. Zwar gibt es keine Sportart mehr, die einem Geschlecht exklusiv vorbehalten ist, doch sind viele Sportarten männlich oder weiblich konnotiert. Daraus ergibt sich eine Vereinbarungspro-blematik, der zwar auch Männer nicht völlig entgehen, von denen aber Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft prinzipiell stärker betroffen sind. So galt etwa das Fußballspiel lange als "Männersport". Anhand dreier Studien wird das Selbstverständnis Fußball spielender Frauen "zwischen Stollen- und Stöckelschuh" umrissen, wobei der Schwerpunkt auf der Konstruktion angeblich geschlechtsspezifischer Eigenschaften sowie dem Verhältnis zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdzuschreibung liegt. Um diesen Geschlechterstereotypen zu entgehen, entwickelten Frauen Strategien des "Genderns", die aber weitere Probleme mit der eigenen Identität, der Außendarstellung nach sich ziehen können. Bei der Konstruktion oder Festschreibung von Geschlechterstereotypen spielen Medien eine entscheidende Rolle, wie anhand des Fußballs der Frauen als des "schöneren" Fußballs oder der in den Medien inszenierten Gefahr der "Vermännlichung" weiblicher Körper gezeigt wird, die im Medienkrieg des Ost-West-Konflikts spezifische Bedeutung erlangte. Das Problem existiert bis heute in veränderter Form, da bei allen Strategien des "Genderns" die Gefahr bleibt, in der Presse nicht gleichermaßen als Sportlerin und Frau wahrgenommen zu werden. Die "Herausforderungen einer Carl-Diem-Biographie", die Frank Becker behandelt, besitzen ein Doppelgesicht: Einerseits geht es um die kon-zeptionellen Herausforderungen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass Diem sowohl eine Persönlichkeit der Zeit- wie der Sportgeschichte war; andererseits um die Probleme, die daraus resultieren, dass Diem eine Symbolfigur für ein bestimmtes Bild von der deutschen Sportgeschichte ist, um das wissenschaftlich wie geschichtspolitisch seit Jahrzehnten heftig gestritten wird. Auf der konzeptionellen Ebene wird in Beckers Aufsatz zudem erörtert, wie eine Biographie nach dem "cultural turn" in der Geschichtswissenschaft angelegt sein muss, in welcher Weise also die Forderung nach der verstärkten Einbeziehung der subjektiven Erfahrungswirklichkeit des Protagonisten eingelöst werden kann. Darüber hinaus sind die Folgen von Bedeutung, die das Durchschneiden von vier Phasen der deutschen Geschichte - Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bundesrepublik - für die Biographie Diems und deren Aufarbeitung hat. Eine Besonderheit von Diems Werdegang besteht auch darin, dass er ein Universalkönner des Sports war, welcher sich noch nicht so weit ausdifferenziert hatte, dass es für den einzelnen nicht mehr möglich gewesen wäre, ihn in seiner Gesamtheit zu überblicken. So war Diem als Journalist und Funktionär, als Organisator und Wissenschaftler, als Sinnstifter und Propagandist für den Sport tätig - der Biograph muss Mittel und Wege finden, dieser enormen Bandbreite in seiner Darstellung gerecht zu werden. - Auf der Ebene der Symbolhaftigkeit Diems und der daraus resultierenden Deutungskämpfe ordnet Becker die Diem-Debatte der Jahre 2010 bis 2013 in die Entwicklung der Sportgeschichtsschreibung in Deutschland ein. Von den gleichen Deutungskämpfen ausgehend analysiert Ralf Schäfer die "Probleme im Umgang mit der NS-Vergangenheit des deutschen Sports am Beispiel von Carl Diem", die zwischen "Verdrängen und Erinnern" oszillieren: Indem man Diem zur positiven Symbolfigur des deutschen und olympischen Sports stilisierte, der den deutschen Sport modernisiert und in die Sphäre eines als diskriminierungsfrei postulierten olympischen Sports geführt habe, wurde Diems NS-Vergangenheit ver-drängt und mehrfach überformt. Noch die zuletzt versuchte Abwehr kritischer Analysen offenbart, dass Teile der deutschen Sporthistoriographie von politischen Reflexen limitiert sind, die dem Kontext des Kalten Krieges und der Sphäre nachträglicher Konfliktaustragung mit den "Achtundsechzigern" entstammen. Auf diese älteren Lagen geschichtspolitischer Auseinander-setzung setzten schon früher gesellschaftliche Debatten um die Namenswürdigkeit Diems auf. Dabei wird auf gesellschaftlicher Ebene ein kritischer Umgang mit der NS-Vergangenheit Diems und des Sports eingefordert, zu dem die deutschen Verbände und die Olympiahistoriker immer noch nicht bereit sind. Die Apologie Diems wirkt aber nicht nur als politisches, sondern auch als wissenschaftliches Modernisierungshemmnis. Der Beitrag unterzieht Diems Karriere im olympischen und deutschen Sport zwischen 1933 und 1950 einer quellenbasierten politik- und gesellschafts-geschichtlichen Analyse, um noch einmal die Verzeichnungen und Prob-leme der älteren Forschung herauszuarbeiten. Besonderes Gewicht liegt auf Diems Tätigkeiten im NS-Regime und in der internationalen olympi-schen Bewegung und seiner Selbstdarstellung vor und nach 1945. Mit ihrer Studie über "Pferdesport und Politik im Nachkriegsdeutsch-land im Zeichen von Kontinuitäten und Diskontinuitäten" analysiert Nele Maya Fahnenbruck eine Sportart, die nur von gesellschaftlichen Eliten betrieben wurde. Sie stellt den Hamburger Pferdesport als dichtes Bezie-hungsgeflecht der höheren Kreise vor, das wegen seines militärischen Ein-schlags und der nationalistischen und konservativen Einstellungen seiner Akteure teils schon vor 1933 anfällig für den aufstrebenden Nationalsozialismus war. Nach 1933 erfreuten sich die Reiterstürme der SS mit ihrem elitären Nimbus besonderer Beliebtheit. So vollzog sich die Neuordnung des Pferdesports nicht nur als Reduzierung der Verbandsvielfalt und Gleichschaltung von oben, sondern auch als freiwillige Anpassung und Selbstkontrolle. Dabei wirkte die für die NS-Herrschaft typische polykratische Organisationskonkurrenz, hier zwischen Wehrmacht, SA und SS, wobei letztere dem Leistungssportgedanken am nächsten stand. Gustav Rau, dessen Karriere wie die Diems vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik reichte, der mehrfach deutsche Olympiateilnahmen und die Reiterwettkämpfe von 1936 organisierte, ist ein Beispiel dafür, dass Denkweisen wie "Reinrassigkeit", "Führerprinzip" und ein Geschichtsbild auf der Basis von "Blut- und Boden" auch bürgerliche Funktionäre affizierten, die keine Nationalsozialisten im engeren Sinn waren, aber doch Funktionen im NS-Regime wahrnahmen. Dabei war vor allem die Mitgliedschaft in der Reiter-SS oft der erste Schritt zur aktiven Teilnahme an NS-Verbrechen bis hin zum Holocaust. Das aber erwies sich für manche Akteure nach 1945 nicht als Hindernis für die Rückkehr in ihre alten gesellschaftlichen Positionen, nachdem sie vor den mangelhaft informierten Alliierten glaubhaft machen konnten, dass es sich bei der Reiter-SS nur um eine gesellschaftliche Vereinigung handelte, wie hier anhand mehrerer Beispiele belegt wird. Autobahnen, Motorsportereignisse und Rennfahrerhelden wie Bernd Rosemeyer gehören bis heute zum festen Erinnerungsrepertoire an die NS-Herrschaft. Das Regime konnte hier seine Modernität demonstrieren, Zukunftsversprechen inszenieren und Identifikation erzeugen, die entweder die braune Gesellschaft insgesamt oder den Rennfahrer als Helden zum Gegenstand hatten. Auch auf diesem Feld sollte die schwarze Uniform den spezifischen Elitebegriff der SS symbolisieren. In seinem Beitrag "Schonungsloses Höchsttempo" gibt Berno Bahro einen organisationsgeschichtlich angelegten Überblick über die "motorsportlichen Aktivitäten der SS". Ihre Anfänge waren bescheiden, wie die SS insgesamt waren auch die SS-Motorstürme der SA unterstellt. Erst nach dem Röhm-Putsch konnte sich die SS aus dieser Umklammerung befreien. Aber auch dann noch musste sie mit anderen NS-Organisationen, vor allem mit dem Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps und der Hitlerjugend, aber auch mit der Wehrmacht, der Reichspost und den Rennställen der Industrie konkurrieren. Die motorisierten Aktivitäten der SS trugen einen Doppelcharakter, einerseits waren sie als paramilitärische Vorbereitung einer späteren Aufrüstung intendiert, andererseits am Leistungssportbegriff orientiert, wie ihn Himmler im Vorfeld der Olympischen Spiele von 1936 entwickelte. Doch zeigt die nüchterne Bilanzierung der Erfolge, dass die SS ihr Image als Motorsportelite eher propagandistischen Anstrengungen als realen Rennsiegen verdankt. Sport wird im Allgemeinen mit Begriffen wie Gesundheit und Lebens-qualität, Freiwilligkeit, Freizeit oder Vergnügen assoziiert. Nationalsozialis-tische Konzentrationslager aber waren Räume, deren Alltag für die Häft-linge von Gewalt und Willkür geprägt war. Der Beitrag von Veronika Springmann "›Entertainment‹ und ›Punishment‹. Die Darstellung von Sport in nationalsozialistischen Lagern auf den Zeichnungen von Alfred Kantor" analysiert Varianten des Sports, die in einer Welt von Terror und Qual, Gefangenschaft und Zwang, Krankheit und Tod stattfanden. Sport scheint auf den ersten Blick nicht in das Bild zu passen, das wir von den Lagern haben. Da Sport und Gewalt beide physisch sind und am Körper ansetzen, kann der Sport leicht zur Gewalt verkehrt werden, indem man der Bewegung die Freiwilligkeit und Selbstkontrolle nimmt und sie dem Zwang unterwirft. Während die Bewegungen im Sport positiv wirken, kann die befohlene Bewegung schmerzhaft und zerstörerisch sein und bis zum Tod führen. In körperbetonten Sportarten kann die Aufhebung der Regeln Gewalt induzieren. Doch gab es auch Sport im herkömmlichen Sinn, als Freizeitgestaltung oder Privileg. Fußball und Boxen verschafften den Häftlingen, sei es als aktive Teilnehmer oder auch als Zuschauer, eine gewisse Ablenkung im Alltag des Konzentrationslagers. Vor dem Hintergrund neuerer Forschungen über die nationalsozialistischen Lager werden hier anhand von drei Bildquellen verschiedene Aspekte des Sports beleuchtet: Sport als Unterhaltung und Freizeitgestaltung für Aktive und Publikum, Sport als Bestrafung in Form von exerziermäßigen Übungen wie befohlenen und mit Gewalt begleiteten Liegestützen, und Sport als Selektion: Anhand von Kniebeugen klassifizieren KZ-Aufseher den gesundheitlichen Zustand von Häftlingen; die sportliche Übung entscheidet über Leben und Tod. Mit der Geschichte der jüdischen Sportbewegung in Deutschland set-zen sich Lorenz Peiffer und Henry Wahlig auseinander. Dabei verwenden sie einen organisationsgeschichtlichen Ansatz, der sich an Martin Gierl anlehnt. Generell ist es ihnen - im Sinne Saul Friedländers - wichtig, die deutschen Juden nicht nur als passive Opfer, sondern auch als eigeninitia-tiv handelnde Menschen zu zeigen. Nachdem in Kaiserreich und Weimarer Republik der größere Teil der Sport treibenden deutschen Juden in Vereinen der allgemeinen Turn- und Sportbewegung, nur ein kleinerer Teil hingegen in rein jüdischen Vereinen organisiert war, kam es nach 1933 infolge der Einführung von ›Arierparagraphen‹ in zahlreichen Vereinen zu einer massiven Verschiebung - die rein jüdischen Vereine bildeten nun das große Sammelbecken für die deutsch-jüdischen Sportler, und mehr noch: Eine Gegenwelt entstand, in der diese Athleten in actu dem NS-Propagandaklischee von den körperlich schwachen Juden widersprachen. Im gesamten Spektrum kultureller Aktivitäten der deutschen Juden nach 1933 erhielt die Sportbewegung, wie Peiffer und Wahlig anhand der Analyse der jüdischen Presse nachweisen, eine stetig wachsende Bedeutung. Aus der sportlichen Betätigung beziehungsweise der Beschäftigung mit ihr zog man den Glauben an die eigene Kraft und Zukunft. Die jüdischen Sportfunktionäre nutzten das Organisationswissen, das sie zuvor in der allgemeinen Turn- und Sportbewegung erworben hatten, was die Autoren als Fortsetzung des Assimilationsprozesses an die deutsche Gesellschaft interpretieren. Bis 1936 waren sogar noch Wettkämpfe zwischen jüdischen und ›arischen‹ Clubs möglich, die allerdings verboten wurden, als nach den Olympischen Spielen von Berlin keine Rücksicht auf die Wirkung im Ausland mehr ge-nommen werden musste. Einen noch größeren Einschnitt bildete freilich die Pogromnacht vom 9. November 1938, in deren Folge den deutschen Juden ihre letzten Wettkampf- und Trainingsmöglichkeiten genommen wurden. Den Schlusspunkt setzte dann das offizielle Betätigungsverbot von Ende 1938/Anfang 1939. In seinem Beitrag über "Das Leistungsprinzip in der Wettbewerbsge-sellschaft 1960-1980" zeichnet Heiko Stoff den Diskurs über verschiedene Leistungsbegriffe nach. Dabei genoss das Leistungsprinzip in der jungen Bundesrepublik besondere Wertschätzung, da es mit Wiederaufbau und Wirtschaftswachstum assoziiert und als positiv gewendeter deutscher Sonderweg galt. Problematisierungen des Leistungsbegriffs als Repression und Zwang wurden auf das Schärfste bekämpft. Der Riss durch die Gesellschaft trennte konservative Verteidiger des Leistungsprinzips und Exponenten der Leistungs- und Konsumkritik. Doch sind alle modernen Gesellschaften Leistungs-, Erfolgs- und Wettbewerbsgesellschaften. Das bedeutet, Leistungen sind ständig zu steigern oder zu optimieren. Der Beitrag zeigt, dass der Leistungsbegriff das historische Produkt eines transdisziplinären und multitemporalen Gefüges ist, dessen Hauptmerkmal die wett-bewerbsökonomische Materialisierung des Körpers darstellt. Dabei wurde das Konzept der Leistung früh zu einer zentralen Kategorie moderner Körperkonzepte. Über den Leistungsbegriff war der moderne Mensch immer schon am Sportlerkörper ausgerichtet, wobei der Begriff "Leistung" chemische, ökonomische, politische und soziale Faktoren verbindet. Das Streben nach Best- und Höchstleistungen entfaltet eine problematische Seite, indem es die Möglichkeit der Leistungsmanipulation aufwertet. Der Leistungskörper wird mit Mitteln der Medizin und der Chemie optimiert, auch was seine Arbeitsleistung angeht; die Verwissenschaftlichung von Körperkonzepten förderte zudem bestimmte Körperpraktiken und von Selbstdisziplin geprägte Lebensweisen. Als Zwang zur Selbstoptimierung durchtränkt das Leistungsprinzip mittlerweile alle Individuen und Lebensbereiche stärker, als dies in den siebziger Jahren vorstellbar war. Um das "Dopingsystem der DDR" angemessen zu kennzeichnen, ord-net Klaus Latzel es in vier verschiedene Problemkreise ein. Zunächst wer-den medizingeschichtliche Grundlagen erläutert: Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts gewonnene Erkenntnis, dass das männliche Geschlechts-hormon Testosteron nicht über die Nerven, sondern über die Blutbahn durch den Körper transportiert wird, bildete gleichsam die Initialzündung für ein breites Spektrum manipulativer Eingriffe, die zunächst vor allem für die Vitalisierung und Verjüngung des Körpers eingesetzt wurden, dann aber auch zur gezielten Leistungssteigerung im Sport dienten. Damit wurden diese Eingriffe - zweitens - zum Bestandteil der modernen Kultur der Optimierung und permanenten Überbietung. Der Sport war gleichsam nur der Brennspiegel einer gesellschaftlichen Praxis, der es in allen Lebensbereichen um Fortschritt und Verbesserung ging. Wo dabei die Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Unerlaubten verliefen, wurde immer wieder neu ausgehandelt. Im dritten Abschnitt analysiert Latzel, wie sich der DDR-Sport auf diesem Feld positionierte. Siege über die westlichen Sportler schienen ein Indiz für die Überlegenheit des eigenen Gesellschaftssystems zu sein; folglich setzte die Sportadministration in Ostberlin alles daran, entsprechende Leistungen möglich zu machen. Von oben organisiert und nach den Regeln der Planwirtschaft umgesetzt, wurden die Sportler-Körper vor den großen Wettkämpfen durch Training und biotechnische Interventionen auf das gewünschte Weltniveau gebracht. Um eine zu einfache Dichotomie zwischen Funktionären als Tätern und Sportlern als Opfern zu vermeiden, weist Latzel im Schlussabschnitt aber darauf hin, dass manche Athletinnen und Athleten auch aus eigenem Antrieb beim Doping mitwirkten, um in der DDR-internen Konkurrenz zu bestehen und die an sportliche Erfolge geknüpften Gratifikationen zu erhalten. An den aktuellen "spatial turn" in den Geistes- und Sozialwissenschaf-ten schließt der Beitrag von Noyan Dinçkal an. Soziales Geschehen wird als an Räume gebunden begriffen, und dies nicht nur in einem physischen, sondern auch in einem sozialkonstruktivistischen Sinne - Räume sind dadurch definiert, dass in ihnen bestimmte Sinnzuschreibungen gelten. Wendet man dieses Konzept auf Sporträume wie Sportplätze, Laufbahnen oder Stadien an, so geraten spezifische Regelwerke, kodifizierte Bewegungsabläufe und Repräsentationsfunktionen in den Blick. Dinçkal konzentriert sich bei seiner Untersuchung auf die Stadien der Weimarer Republik. Stärker als die sportlichen Wettkämpfe, die dort abgehalten wurden, interessiert ihn der Sportkonsum, der immer größeren Publikumsmassen ermöglicht wurde. Die Gestalt des Sportkonsums hing wiederum von der räumlichen Struktur ab, die von der Stadionarchitektur vorgegeben wurde. Mit Jan Tabor begreift Dinçkal das Stadion als eine ›Maschine zur Handhabung von Massen‹. Damit sind nicht nur Techniken für das geordnete Zufließen, Verweilen und Abfließen einer großen Menschenmenge ge-meint. Es geht auch um die Lenkung der Aufmerksamkeit: Die Stadionarchitektur ermöglicht die Beobachtung des Spielfeldes ebenso wie die ständige Selbstbeobachtung des Publikums. Erstere Beobachtung lädt dazu ein, die passive Rolle zu verlassen und durch Anfeuerung und Schmähung auf das sportliche Geschehen aktiven Einfluss zu nehmen; letztere fördert die symbolische Aushandlung von sozialen Rollen. Dinçkal arbeitet heraus, dass das egalitäre Massenpublikum in den zwanziger Jahren ein Leitbild blieb, dem die Realität erst im Ansatz folgte: Stehplätze, Tribüne und Loge trugen einem immer noch ausgeprägten Distinktionsbedürfnis bei den Zuschauern Rechnung. Als für eine dauerhafte Nutzung angelegte Bauten, so Dinçkals Fazit, waren die Stadien nicht geeignet, wie Seismographen auf sozialkulturelle Tendenzen und Bedürfnisse zu reagieren. Eva Maria Gajek untersucht das "Wechselverhältnis von Sport und Medien im 20. Jahrhundert" am Beispiel der Fernsehübertragungen von Olympischen Spielen. Ihr Konzept von Medialisierung zielt nicht nur auf die Abbildung des Sportereignisses im Medium, sondern auch auf die Rückwirkungen des Mediums auf das Ereignis selbst ab - um die Übertragung zu erleichtern, musste sich das Ereignis an die Anforderungen des Mediums anpassen. Dies betraf nicht nur das Zeitmanagement der sport-lichen Wettkämpfe, sondern Architektur und technische Ausrüstung des Stadions. Bei den Münchner Spielen 1972 war das Flutlicht so hell, dass es die Sicht der Zuschauer behinderte - aber für die Kameraleute des Fernsehens hervorragende Arbeitsbedingungen schuf. Zudem sorgten die Einnahmen aus dem Verkauf der Übertragungsrechte dafür, dass das Sportereignis eine weitaus pompösere Form annehmen konnte, als es sonst der Fall gewesen wäre. Diese Tendenz setzte mit den Olympischen Spielen von Rom 1960 ein. Zuvor hatte das Fernsehen nur eine marginale Rolle gespielt; bei den Berliner Spielen von 1936, als es zum ersten Mal zum Einsatz kam, war es nicht viel mehr als ein Kuriosum gewesen. Das Fernsehen seinerseits profitierte von der Popularität des Sports und setzte die Übertragungen zu einer Form der Eigenwerbung ein, die vor allem für die Konkurrenz zu den Printmedien bedeutsam war. Vor den Münchner Spielen sparten ARD und ZDF jahrelang an, um sich bei dem Mega-Event Olympiade umso wirkungsvoller präsentieren zu können. Zur Gesamtinszenierung von Olympischen Spielen im Fernsehen gehörte immer auch die Politik. 1960 in Rom nutzte die italienische Regierung das Ereignis, um einer internationalen Isolierung des Landes entgegenzuwirken; 1972 bot es bundesdeutschen Politikern eine Bühne im Vorfeld der Bundestagswahl im September des Jahres. 1980 in Moskau schließlich drückte sich der Boykott der Spiele durch die Bundesrepublik auch in einem weitgehenden Fernsehboykott aus.