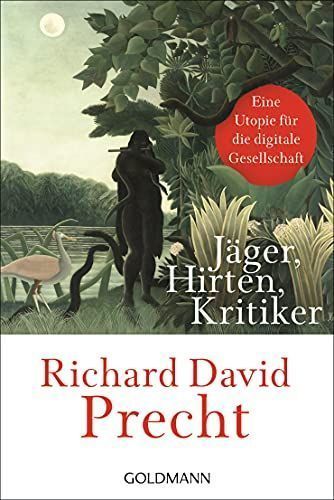
Jäger, Hirten, Kritiker Eine Utopie für die digitale Gesellschaft
Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die Vergangenheit. Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt ein Verlust? Für Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Doch dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. Denn zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen nicht! Dieses Buch will zeigen, wo die Weichen liegen, die wir richtig stellen müssen. Denn die Zukunft kommt nicht - sie wird von uns gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?
Reviews
里森@lisson
Highlights
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
Page 92
里森@lisson
Page 87
里森@lisson
里森@lisson
里森@lisson
Page 83
里森@lisson
Page 73
里森@lisson
Page 49
里森@lisson
Page 49
里森@lisson